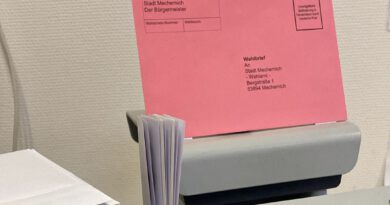„Troststeine für die Zukunft“
Einweihung von fünf Stolpersteinen für die in die USA geflohene Familie Schwarz/Zimmermann – Emotionaler Besuch aus Colorado – Wichtiges Zeichen für Menschlichkeit
Mechernich – Über 300 Jahre lang hatten die Familien Schwarz und Zimmermann in Mechernich und Kommern gelebt. Hergekommen waren sie auf der Flucht vor der spanischen Inquisition, hatten sich mit harter Arbeit ein ehrliches Leben aufgebaut und für ihr deutsches Kaiserreich teils sogar im ersten Weltkrieg gekämpft. Doch plötzlich war alles anders. Nur, weil sie Juden waren.

So versammelten sich am Wochenende rund 60 Menschen in der Mechernicher Bahnstraße 53, um fünf Stolpersteine einzuweihen. Sie erinnern an Louis (geb. 1877) und Fanny Zimmermann (geb. 1876), deren Töchter Jetty Schwarz (geb. 1908) und Else Kahn (geb. 1910) sowie Sohn Adolf Zimmermann (geb. 1912). Die Familie war 1938 vor dem Nazi-Regime in die USA geflohen – und sich beim ersten Anblick der Freiheitsstatue weinend in die Arme gefallen. Sie hatten es geschafft – von Verwandten, die geblieben waren, hörten sie nie meist wieder etwas.
Begleitet von andächtigen Musikpausen, die Nicole Besse (Geige) und Erik Arndt (Akkordeon) mit jüdischen Liedern wie „Shalom Chaverim“ gestalteten, entstand eine dichte Atmosphäre aus Trauer, Dankbarkeit und Hoffnung. Unter den Gästen: Mechernichs Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick, der stellvertretende Landrat Leo Wolter und Dezernent Ralf Claßen.

Besonders bewegend war die Anwesenheit der direkten Nachfahrin Jaqueline „Jacky“ Schwarz, Tochter von Jetty und Josef Schwarz. Angereist war sie mit ihrem Mann Jim Vacca und ihren beiden Kindern Emma und Daniel aus Colordo in den USA. Als Kind hatte Jacky noch mit ihren Eltern und Großeltern in einem Haus in New York zusammengewohnt. Mit stockender Stimme, aber in sehr gutem Deutsch sagte sie: „Hier zu sein ist sehr emotional für mich, mein Herz ist sehr voll… Ich habe mich heute öfter so gefühlt, als würde ich gleich losweinen. Ich bin sehr dankbar – meine Mutter und mein Vater wären es ebenso.“
Deutsche, „die zufällig jüdisch waren“
Für Schwarz war dieser Moment wie ein Stück Heilung: „Hier zu sitzen, am Zuhause meiner Vorfahren, ist für mich ein Stück innerer Frieden. Oft haben sie von ihrer Zeit hier erzählt, in schönen Erinnerungen geschwelgt.“ Kurzum: „Äußerlich lebten meine Eltern in New York, innerlich aber in Mechernich und Kommern.“ Für sie sei umso klarer, auch in Hinblick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen, einem Angriffskrieg auf europäischem Boden und der Präsidentschaft Donald Trumps in ihrem Heimatland: „Hass hat noch nie ein Land großartig gemacht.“ Umso glücklicher sei sie über die kleinen glänzenden Denkmäler zu Ehren ihrer Familie: „Für mich sind Stolpersteine auch Troststeine für die Zukunft.“

Auch ihre Tochter Emma sprach über die besonderen Eindrücke ihres ersten Deutschlandbesuchs: „Die alten Gebäude zu sehen, hier zu stehen, wo meine Familie über Generationen gelebt hat, ist sehr emotional – und macht alles so viel echter.“

Die Geschichte der Familie reicht weit zurück: Rund 300 Jahre lang lebten die Zimmermanns und Schwarzens in Mechernich und Kommern. Sie betrieben Vieh- und Pferdehandel, führten Geschäfte in der Stadt, nahmen aktiv am gesellschaftlichen Leben teil, feierten Kirmes und sangen deutsche Volkslieder. Sie verstanden sich selbstverständlich als Deutsche – „die zufällig jüdisch waren“. Doch dann kam die Entrechtung, der Terror, die Flucht.

Ein befreundeter Schreiner warnte sie im Jahr 1937, dass ihre Leben nicht mehr sicher seien. Danach half er ihnen bis zu ihrer Flucht so gut er konnte und überlegte sogar, einen geheimen Raum zu bauen, um die Familie darin vor den Schergen des NS-Regimes zu verstecken. „Ich bin ihm bis heute dankbar“, so Schwarz: „und einige seiner liebevoll gefertigten Möbel stehen bis heute in meinem Haus!“
Dann wurde es richtig brenzlig. 1938, kurz vor der Flucht, wurde Josef Schwarz von einer Gruppe Nazis angehalten und, da er blond und blauäugig war, nach dem „Wohnhaus des Juden Josef Schwarz“ gefragt. Er deutete nur mit dem Kopf nach hinten. Über seinen Bruder Ernst, der eine Facharztausbildung zum Psychiater bei Siegmund Freud gemacht hatte, konnte er schließlich die benötigten Visa besorgen.
„Wir sind alle nur Menschen!“
Gisela Freier von der Arbeitsgruppe „Forschen – Gedenken – Handeln“, die mit ihrem Mann Wolfgang, Rainer Schulz und Elke Höver Aufklärungsarbeit betreibt, erinnerte daran, wie alles mit einer E-Mail aus den USA begann: „My Jewish mother and grandparents lived in Mechernich“, schrieb Jacky Schwarz an Bürgermeister Dr. Schick: „Für uns war diese Nachricht ein Anlass zu großer Freude, denn sie zeigt, dass die NS-Diktatur ihr Ziel nicht erreicht hat“, sagte Freier.

Leider hatten nicht alle so viel „Glück“. So verwies sie beispielsweise auf Dokumente im Stadtarchiv, in denen sogar das Kinderbett der kleinen Hanna Eiffeler akribisch aufgelistet und versteigert wurde, um jede Spur jüdischen Lebens zu tilgen: „Jeder Stolperstein ist eine Mahnung, nicht wegzuschauen, wenn Demokratie verunglimpft und Menschenwürde beleidigt wird.“
Auch Rainer Schulz dankte für die große Anteilnahme: „Sie zeigen heute, dass Sie mit uns ein Zeichen setzen wollen – gegen Fremdenfeindlichkeit, Menschenverachtung und das Gedankengut der ewig Gestrigen.“ Besonders dankte er auch jenen, die die wichtige Arbeit der Arbeitsgruppe finanziell unterstützen, und lud zugleich zum nächsten Gedenkgang am Montag, 10. November, ein, der an der Stelle der ehemaligen Synagoge beginnen wird.

Bürgermeister Dr. Hans-Peter Schick erinnerte in seiner Ansprache an die besondere Bedeutung der Stolpersteine: „Heute stehe ich vor Namen von Menschen, die fliehen konnten. Die meisten, an die wir mit Stolpersteinen erinnern, mussten ihr Leben im Konzentrationslager lassen.“ Er fragte, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass einstige Freunde und Nachbarn zu Feinden wurden, von Hass zerfressen. „Denkmäler wie diese sollen uns davor bewahren, die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen. Denn: Es gibt keine Unterschiede. Wir sind alle nur Menschen!“
So verband sich an diesem besonderen Tag Geschichte mit Gegenwart: Worte, Musik und glänzende Messingplatten machten spürbar, was Erinnerung leisten kann – sie mahnt, gibt Opfern ihre Namen zurück, stiftet Verbundenheit und schenkt den Nachkommen ein Stück inneren Frieden.
pp/Agentur ProfiPress